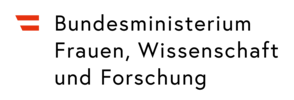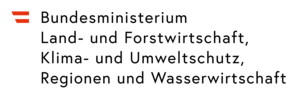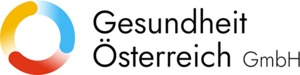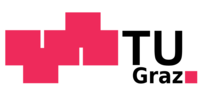25. Österreichischer Klimatag unter dem Motto "Lebens- und Wirtschaftsraum Alpen"
23.-25. April 2025, Universität Innsbruck
Der 25. Österreichische Klimatag stand in diesem Jahr ganz im Zeichen des alpinen Raums. Unter dem Motto „Lebens- und Wirtschaftsraum Alpen“ widmete sich die Veranstaltung den besonderen Herausforderungen und Chancen, die sich durch den Klimawandel in Gebirgsregionen ergeben. Der Austragungsort Innsbruck – mitten im Herz der Alpen – bot dafür nicht nur eine symbolisch passende Kulisse, sondern mit der Universität Innsbruck auch eine wissenschaftlich hervorragend aufgestellte Gastgeberin.
Die Universität Innsbruck verfügt über eine langjährige Forschungstradition im Bereich der alpinen Klimawandelanpassung und -folgenabschätzung. Bereits 2014 richtete sie den Klimatag aus und konnte auch elf Jahre später mit ihrer Expertise in Bereichen wie Gletscherforschung, Naturgefahren, Biodiversität und nachhaltiger Regionalentwicklung ihre zentrale Rolle in der österreichischen Klimaforschungslandschaft unterstreichen. Damit war die Universität Innsbruck erneut Gastgeberin der wichtigsten Netzwerkveranstaltung der österreichischen Klimaforschungscommunity.
Der Alpenraum zählt zu den Regionen Europas, die von der Klimakrise besonders betroffen sind. Die Temperaturen steigen hier rund doppelt so schnell wie im globalen Mittel, was zu drastischen Veränderungen wie dem Rückgang der Gletscher, der Zunahme von Naturgefahren oder dem Wandel der alpinen Vegetation führt. Innsbruck hat sich mittlerweile als Hotspot für Hitzetage etabliert – ein deutliches Anzeichen für die fortschreitende Klimaerwärmung im Gebirge. Zudem ist der Alpenraum stark besiedelt und wirtschaftlich genutzt – von Tourismus über Landwirtschaft bis hin zur Energieversorgung. Umso wichtiger ist die enge Zusammenarbeit von Wissenschaft, Politik, Verwaltung und Zivilgesellschaft, um regionale Anpassungs- und Vermeidungsstrategien zu entwickeln und umzusetzen.
Über 200 Teilnehmende aus Wissenschaft, Verwaltung, Wirtschaft und Forschungsförderung sind in Innsbruck zusammengekommen, um aktuelle Forschungsergebnisse im Rahmen des 25. Klimatags zu diskutieren, Projekte zu präsentieren und Netzwerke zu vertiefen (das Programm ist hier einsehbar).
Schon im Vorfeld des Klimatags lud der Climate Walk unter dem Motto „Alpin-Urban“ dazu ein, klimarelevante Herausforderungen und Lösungsansätze im städtischen Raum Innsbrucks gemeinsam zu erkunden. In transdisziplinärem Austausch mit ortskundigen Expert:innen wurden unter anderem Hitzeinseln, grün-blaue Infrastrukturen und städtische Transformationsprozesse sichtbar gemacht. Der Spaziergang bot neue Perspektiven auf den Lebens- und Wirtschaftsraum Alpen und klang bei anregenden Gesprächen im Agnes Heller Haus aus.
Beim traditionellen Icebreaker am Mittwochabend stellte sich die gastgebende Universität Innsbruck vor. Vizerektor Gregor Weihs eröffnete die Veranstaltung, gefolgt von einem Impuls des Forschungsschwerpunkts „Alpiner Raum“ zur Einstimmung des diesjährigen Themas „Lebens- und Wirtschaftsraum Alpen“. Die Kunstausstellung “Echos of landscape lost” zum Gletscherrückgang setzte einen künstlerischen Rahmen für den Konferenzauftakt und war danach die gesamte Konferenz über besuchbar. Einen weiteren thematischen Akzent setzte die Vorstellung des Projektes PEAK des Büros für Öffentlichkeitsarbeit, welches neue Wege der Wissenschaftskommunikation rund um Themen wie Klima und Biodiversität beleuchtet.
Am Donnerstag folgte die offizielle Eröffnung mit Vertreter:innen der Veranstalter:innen sowie Fördergeber:innen so waren neben Harald Rieder (CCCA Obmann) und Irene Häntschel-Erhart (Vizerektorin UIBK) auch Gernot Wörther (stv. Geschäftsführer Klima- & Energiefonds), Jakob Wiesbauer-Lenz (BMLUK) und Katarina Stefaner (BMFWF) auf der Bühne.
Im Anschluss fand die Keynote von Margreth Keiler (Universität Innsbruck) mit dem Titel „Klimawandel, Risiko und Resilienz“ zentrale Herausforderungen für den Lebens- und Wirtschaftsraum Alpen (hier geht es zur Aufzeichnung der Keynote) statt. Darin wurde deutlich, dass der Alpenraum besonders stark vom Klimawandel betroffen ist – etwa durch zunehmende Naturgefahren, Veränderungen im Wasserhaushalt und Herausforderungen für Tourismus, Landwirtschaft und Infrastruktur. Gleichzeitig zeigte Keiler auf, wie wichtig eine strategisch geplante Anpassung und ein interdisziplinärer Zugang zur Förderung der Resilienz sind. In der anschließenden Paneldiskussion mit dem Thema "Schöne Aussicht, unsichere Zukunft? Wie der Alpenraum den Spagat zwischen Naturidylle, Wirtschaftsraum und Klimaresilienz schaffen kann." diskutierten Daniel Huppmann (IIASA), Margreth Keiler (Universität Innsbruck) und Christine Schermer (Stadt Innsbruck), wie der Alpenraum klimaresilient gestaltet werden kann, ohne seine ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Qualitäten zu verlieren. In der Paneldiskussion wurde betont, dass eine klimaresiliente Zukunft im Alpenraum nur durch eine enge Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft, Politik, Verwaltung, Wirtschaft und Zivilgesellschaft möglich ist. Damit Wissenschaft wirksam zur Transformation beitragen kann, braucht es stabile Strukturen für transdisziplinären Austausch – derzeit fehlen diese weitgehend. Entsprechend wurde an Universitätsleitungen und Ministerien appelliert, solche Aktivitäten auch im Hinblick auf wissenschaftliche Karrieren stärker zu fördern. Zugleich zeigte sich die zentrale Rolle der Bürger:innenbeteiligung: In vielen Fällen ist das Bewusstsein in der Bevölkerung für die Notwendigkeit und Akzeptanz von Klimamaßnahmen weit entwickelt als vorweg angenommen. Um wirksame Maßnahmen umzusetzen, müssen alle sozialen Gruppen aktiv eingebunden und unterschiedliche Perspektiven berücksichtigt werden – denn nur gemeinsam kann die Klimakrise bewältigt werden.
Die altbewährten wissenschaftlichen Sessions setzten thematische Schwerpunkte in den Bereichen: „Klimamodellierung & Klimafolgen“, „Ressourcenverfügbarkeit & Nutzung“, „Wissenschaft & Gesellschaft“ und „Mensch & Klima“. In jeder Session waren jeweils etwa 5 Vorträge zu hören. Außerdem wurde dieses Jahr bereits zum zweiten Mal eine innovative Session organisiert, welche Raum für kreative Präsentation bot, die bewusst vom klassischen Frontalvortrag abwichen. Die ausgewählten Beiträge zeichneten sich durch innovative Elemente wie Rollenspiel, Storytelling und Science Slam sowie durch kreative Visualisierungen in Form von Geschichten mit Bildern und Requisiten aus. Diese Formate trugen zur Belebung des wissenschaftlichen Austauschs bei. Erstmals gab es im Rahmen einer wissenschaftlichen Session auch einen kurzen Energizer, um die Teilnehmenden an einem langen Konferenztag zu gemeinsamer Bewegung zu animieren.
Auch die etablierten ACRP-Sessions fanden wieder großen Anklang. In diesem Rahmen durchliefen 22 aktuelle Projekte die sorgfältige Qualitätssicherung des Austrian Climate Research Programme (ACRP). Die Begutachtung durch das ACRP-Steering Committee gewährleistete eine fundierte wissenschaftliche Bewertung und unterstrich den hohen fachlichen Standard der eingereichten Vorhaben.
In den Pausen boten die Poster-Talks am 24. und 25. April 2025 Gelegenheit zum Austausch zu den wissenschaftlichen Postern. Teilnehmende konnten sich in entspannter Atmosphäre mit den präsentierenden Wissenschaftler:innen vernetzen und vertiefende Gespräche zu den ausgestellten Postern führen.
Im Rahmen des Workshops zwischen Wissenschaft und Verwaltung zum Thema „Planen mit Weitblick: Praxisorientierte Nutzung hochaufgelöster Klimaanalysen für die Verwaltung“ luden das Land Tirol und das CCCA zum fachlichen Austausch über die praxisnahe Nutzung hochaufgelöster Klimaanalysen in der Verwaltung ein. Vier Impulsvorträge lieferten wertvolle Einblicke und bildeten die Grundlage für eine lebendige Diskussion, in der sich ein reger Austausch zwischen Vertreter:innen aus Verwaltung und Wissenschaft entwickelte. Es konnten nicht nur wichtige inhaltliche Impulse gesetzt, sondern auch neue Kontakte geknüpft und die Zusammenarbeit über Sektorengrenzen hinweg gestärkt werden.
Am Abend des 24. April fand die Abendveranstaltung statt, welche ebenfalls in Kooperation mit dem Land Tirol veranstaltet wurde. Die Teilnehmenden konnten den Konferenztag nicht nur gemütlich bei einem gemeinsamen Abendessen ausklingen lassen, sondern sich auch einer kreativen Herausforderung stellen. Dabei sind fünf spannende und lustige Geschichten entstanden, die dem Publikum vorgetragen wurden.
Auch die Medien zeigten Interesse am Klimatag: Vertreter:innen der Presse waren vor Ort, der ORF berichtete sogar in einem ausführlichen Artikel über die Veranstaltung – zum ORF-Beitrag.
Besonders erfreulich war das positive Feedback der Teilnehmenden zu Organisation und Atmosphäre des Klimatags. Die Veranstaltung wurde zudem als „Green Meeting“ zertifiziert und die Anreise aller Teilnehmenden wurde im Sinne der CO2-Emissionen kompensiert. Für die Kompensation wurde die BOKU Kompetenzstelle für Klimaneutralität als Partner ausgewählt. Der Kompensationsbetrag wird im Rahmen des Projektes Green Seed eingesetzt.
Der 25. Österreichische Klimatag wurde durch die wertvolle Unterstützung zahlreicher Institutionen ermöglicht. Ein besonderer Dank gilt dem Klima- und Energiefonds, dem Bundesministerium für Frauen, Wissenschaft und Forschung (BMFWF), sowie dem Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft (BMLUK). Ebenso danken wir allen Teilnehmenden für ihre engagierten Beiträge und spannenden Diskussionen. Wir freuen uns schon jetzt, Sie von Mittwoch, 8. April bis Freitag, 10. April 2026 beim 26. Klimatag an der Universität Wien wieder begrüßen zu dürfen!
Unterhalb finden Sie Impressionen zu den einzelnen Programmpunkten. Die Fotorechte liegen beim CCCA.
- CCCA-Preise
- Climate Walk
- Icebreaker hosted by Uni Innsbruck
- Eröffnung, Keynote und Panel-Diskussion
- Wissenschaftliche Sessions
- ACRP-Sessions
- Poster-Sessions und Pausen
- Workshop zur Vernetzung von Verwaltung und Wissenschaft in Kooperation mit dem Land Tirol
- Abendveranstaltung in Kooperation mit dem Land Tirol
- Unterstützer:innen des 25. Österreichischen Klimatags
CCCA-Preise
Der CCCA-Nachwuchspreis für das Jahr 2025 wurde an zwei exzellente Nachwuchswissenschaftlerinnen vergeben, deren Beiträge sich durch wissenschaftliche Tiefe und hohe Relevanz für die Klimaforschung auszeichneten:
- Monica Barman (Universität Salzburg, Leibniz Institute of Vegetable and Ornamental Crops) für das Paper:
„Effects of drought stress on male and female flowers and pollinator visits in Styrian oil pumpkin plants“ - Theresa Boiger (Universität Graz) für das Paper:
„Optimizing the Utilization of Harvested Wood Products for Maximum Greenhouse Gas Emission Reduction in a Bioeconomy: A Multi-Objective Optimization Approach“
Auch die CCCA-Posterpreise waren heuer wieder fixer Bestandteil der Tagung. Alle Teilnehmer:innen konnten während der Veranstaltung die ausgestellten Poster bewerten. Auf dieser Basis hat eine Jury, bestehend aus Ina Meyer (WIFO), Lorenzo Rieg (Universität Innsbruck) und Simon Tschannett (weaherpark & CCCA-Vorstand), die besten Einreichungen ausgewählt.
Folgende Poster wurden auf die ersten drei Plätze gewählt:
- Platz: P11 Barbara Steinbrunner (TU Wien): Soil-Walks: Bewusstsein für Flächeninanspruchnahme, Versiegelung und Innenentwicklung
- Platz: P09 Marianne Bügelmayer-Blaschek (AIT): KNOWING how to deal with climate change - Storytelling für mehr Bewusstsein und Empowerment
- Platz: P04 Katharina Pöll (Universität Innsbruck): If you saw a heat wave at the beach, would you wave back? Estimating impacts of climate change on tourism demand in the Mediterranean
Climate Walk
Climate Walks / Stadtspaziergänge / Exkursionen sind ein transdisziplinäres Format, um gemeinsam mit gesellschaftlichen Akteur:innen Lösungen für die Klimakrise zu erkunden. Ein Climate Walk schafft neue Perspektiven und lässt Herausforderungen (z.B. Hitzebelastung) und Best Practices (z.B. grün-blaue Infrastruktur oder Begegnungszonen) erleben. Ortskundige Inputgeber:innen vermittelten beim Climate Walk Innsbruck Hintergrund und Kontext.
Icebreaker hosted by Uni Innsbruck
Eröffnung, Keynote "Klimawandel, Risiko und Resilienz: Herausforderungen für den Lebens- und Wirtschaftsraum Alpen" und Paneldiskussion “Schöne Aussicht, unsichere Zukunft? Wie der Alpenraum den Spagat zwischen Naturidylle, Wirtschaftsraum und Klimaresilienz schaffen kann.”
Poster-Sessions und Pausen
Workshop zur Vernetzung von Verwaltung und Wissenschaft in Kooperation mit dem Land Tirol - “Planen mit Weitblick: Praxisorientierte Nutzung hochaufgelöster Klimaanalysen für die Verwaltung”
Unterstützer:innen des 25. Österreichischen Klimatags
Der 25. Österreichische Klimatag wurde durch die Unterstützung folgender Einrichtungen ermöglicht, bei denen wir uns im Namen des gesamten CCCA herzlich bedanken möchten: